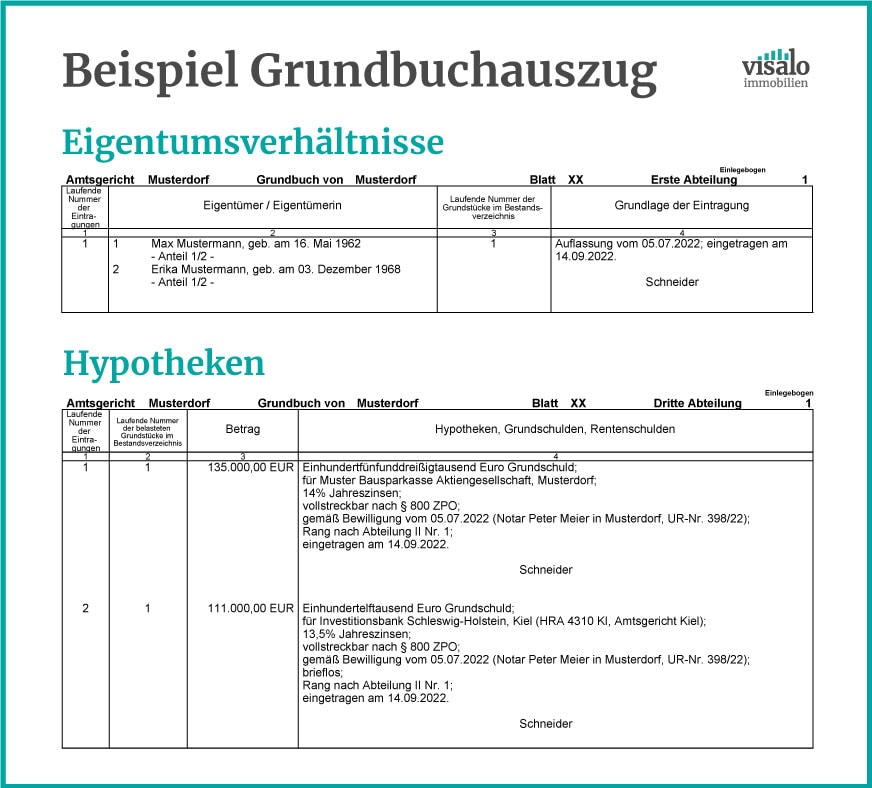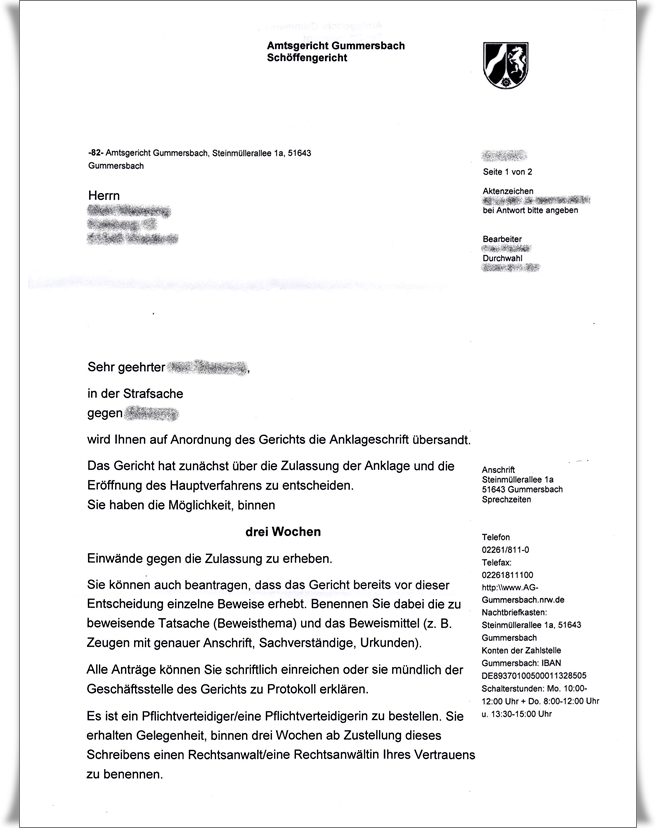Materialgestützte Erörterung Beispiel Klasse 10

Die materialgestützte Erörterung ist eine häufige Aufgabenform im Deutschunterricht der 10. Klasse. Sie verbindet das Verfassen einer Argumentation mit der Analyse und dem Gebrauch von vorgegebenen Texten, den sogenannten Materialien. Ziel ist es, eine eigene begründete Position zu einem Thema zu entwickeln und diese überzeugend darzustellen, wobei die Materialien als Grundlage und Stütze dienen. Dieser Artikel erklärt anhand eines Beispiels, wie man eine materialgestützte Erörterung in der 10. Klasse angehen kann.
Was ist eine materialgestützte Erörterung?
Im Kern ist eine Erörterung eine argumentative Auseinandersetzung mit einer bestimmten Fragestellung. Bei der materialgestützten Form wird diese Auseinandersetzung durch die Bereitstellung von Texten oder anderen Medien gelenkt. Diese Materialien enthalten Informationen, Meinungen und Argumente, die für die Bearbeitung des Themas relevant sind. Der Schüler muss diese Materialien verstehen, analysieren und kritisch bewerten, um sie dann für die eigene Argumentation zu nutzen.
Die wesentlichen Schritte einer materialgestützten Erörterung sind:
- Verständnis der Aufgabenstellung: Was genau soll erörtert werden? Welche Positionen sind möglich?
- Analyse der Materialien: Was sind die Hauptaussagen der Texte? Welche Argumente werden angeführt? Welche Perspektiven werden dargestellt?
- Entwicklung einer eigenen Position: Welche Meinung habe ich zu dem Thema? Welche Argumente kann ich zur Unterstützung meiner Position anführen?
- Verfassen der Erörterung: Einleitung, Hauptteil (mit Argumentation und Materialbezug), Schluss.
Beispiel: Das Thema "Handynutzung in der Schule"
Nehmen wir an, die Aufgabenstellung lautet: "Erörtere die Frage, ob Handys im Schulunterricht erlaubt sein sollten. Berücksichtige dabei die folgenden Materialien." Die Materialien könnten beispielsweise sein:
- Ein Zeitungsartikel, der die Vorteile der Handynutzung im Unterricht (z.B. Recherche, interaktive Lernmethoden) hervorhebt.
- Ein Kommentar, der die Nachteile (z.B. Ablenkung, Cybermobbing) betont.
- Ein Interview mit einem Lehrer, der seine Erfahrungen mit der Handynutzung im Unterricht schildert.
- Eine Statistik über die Handynutzung von Jugendlichen.
Die Analyse der Materialien
Der erste Schritt ist die gründliche Analyse der Materialien. Hierbei sollte man folgende Fragen beantworten:
Analyse des Zeitungsartikels (Vorteile):
- Hauptaussage: Handys können den Unterricht bereichern und effektiver gestalten.
- Argumente:
- Schneller Zugriff auf Informationen für Recherchen.
- Nutzung von Apps für interaktive Übungen.
- Förderung der Medienkompetenz.
- Beispiele: Nennung konkreter Apps oder Unterrichtssituationen.
Analyse des Kommentars (Nachteile):
- Hauptaussage: Handys stören den Unterricht und bergen Gefahren.
- Argumente:
- Ablenkung durch Spiele, soziale Medien und private Nachrichten.
- Cybermobbing und Verbreitung von ungeeigneten Inhalten.
- Ungleichheit, da nicht alle Schüler ein Smartphone besitzen.
- Beispiele: Beschreibung von typischen Störsituationen im Unterricht.
Analyse des Interviews mit dem Lehrer:
- Hauptaussage: Der Lehrer schildert sowohl positive als auch negative Erfahrungen.
- Argumente:
- Positive Erfahrungen: Handys können motivierend wirken und den Unterricht abwechslungsreicher machen.
- Negative Erfahrungen: Disziplinprobleme, Missbrauch der Geräte.
- Schlussfolgerung des Lehrers: Eine klare Regelung ist notwendig, um die Vorteile zu nutzen und die Nachteile zu minimieren.
Analyse der Statistik:
- Hauptaussage: Die Statistik zeigt, dass ein Großteil der Jugendlichen ein Smartphone besitzt und es regelmäßig nutzt.
- Relevanz: Unterstreicht die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Handynutzung auseinanderzusetzen.
Entwicklung der eigenen Position
Nach der Analyse der Materialien muss man sich eine eigene Meinung bilden. Welche Argumente überzeugen mich am meisten? Wie bewerte ich die Vor- und Nachteile? Bin ich für oder gegen die Handynutzung im Unterricht, oder nehme ich eine differenziertere Position ein?
Beispiel: Man könnte zu dem Schluss kommen, dass eine generelle Erlaubnis von Handys im Unterricht nicht sinnvoll ist, aber eine kontrollierte Nutzung unter bestimmten Bedingungen durchaus Vorteile bringen kann. Dies wäre eine differenzierte Position.
Das Verfassen der Erörterung
Die Erörterung sollte folgende Struktur haben:
Einleitung:
- Hinführung zum Thema: Warum ist das Thema relevant?
- Formulierung der Fragestellung: Klare und präzise Formulierung der Frage, die erörtert werden soll. (z.B. "Die Frage, ob Handys im Schulunterricht erlaubt sein sollten, ist von großer Bedeutung, da sie die Lernumgebung und das Verhalten der Schüler beeinflusst.")
- Kurze Vorstellung der eigenen Position: Andeutung der eigenen Meinung (z.B. "Im Folgenden werde ich erörtern, dass eine pauschale Erlaubnis von Handys im Unterricht problematisch ist, eine gezielte Nutzung jedoch sinnvoll sein kann.").
Hauptteil:
- Darstellung der Argumente für die eine Seite (z.B. Vorteile der Handynutzung):
- Argument 1: Schneller Zugriff auf Informationen. (Bezug zum Zeitungsartikel: "Laut Artikel X ermöglicht die Handynutzung eine schnelle Recherche zu Unterrichtsthemen...")
- Argument 2: Nutzung von Apps für interaktive Übungen. (Bezug zum Zeitungsartikel: "Der Artikel nennt die App Y als Beispiel für eine interaktive Lernmethode...")
- Darstellung der Argumente für die andere Seite (z.B. Nachteile der Handynutzung):
- Argument 1: Ablenkung durch Spiele und soziale Medien. (Bezug zum Kommentar: "Der Kommentar von Z betont, dass die Ablenkung durch Handys ein großes Problem darstellt...")
- Argument 2: Gefahr von Cybermobbing. (Bezug zum Kommentar: "Zudem wird auf die Gefahr von Cybermobbing hingewiesen, was schwerwiegende Folgen für die Betroffenen haben kann...")
- Auseinandersetzung mit den Argumenten:
- Entkräftung von Gegenargumenten: Warum sind die Argumente der Gegenseite nicht überzeugend? (z.B. "Zwar mag es Ablenkung geben, jedoch kann dies durch klare Regeln und Aufsicht minimiert werden.")
- Stärkung der eigenen Argumente: Warum sind meine Argumente überzeugender? (z.B. "Die Möglichkeit der schnellen Recherche überwiegt die Gefahr der Ablenkung, da sie den Unterricht dynamischer und aktueller gestalten kann.")
- Bezugnahme auf die Materialien: Zitieren, paraphrasieren und interpretieren der Materialien zur Unterstützung der eigenen Argumentation. Achte darauf, die Quellen korrekt anzugeben!
- Eigene Beispiele und Erfahrungen: Eigene Beobachtungen und Erfahrungen können die Argumentation zusätzlich untermauern.
Schluss:
- Zusammenfassung der wichtigsten Argumente: Kurze Wiederholung der zentralen Punkte.
- Formulierung eines Fazits: Beantwortung der Fragestellung auf Grundlage der Argumentation. (z.B. "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine generelle Erlaubnis von Handys im Unterricht aufgrund der Ablenkungsgefahr und der Möglichkeit von Cybermobbing nicht sinnvoll ist. Eine kontrollierte Nutzung unter pädagogischer Aufsicht und klaren Regeln kann jedoch den Unterricht bereichern und die Medienkompetenz der Schüler fördern.")
- Ausblick oder Appell: Anregung zum weiteren Nachdenken oder Formulierung eines Wunsches. (z.B. "Es ist wichtig, dass Schulen und Eltern gemeinsam Konzepte entwickeln, die eine sinnvolle und verantwortungsvolle Nutzung von Handys im Unterricht ermöglichen.")
Wichtige Tipps für die materialgestützte Erörterung
- Genaue Aufgabenstellung lesen: Was wird gefordert?
- Materialien gründlich analysieren: Hauptaussagen, Argumente, Perspektiven.
- Eigene Position klar entwickeln: Für welche Meinung entscheidest du dich?
- Argumente überzeugend darlegen: Begründe deine Meinung mit nachvollziehbaren Argumenten.
- Bezug zu den Materialien herstellen: Zitiere, paraphrasiere und interpretiere die Texte.
- Klare Struktur einhalten: Einleitung, Hauptteil, Schluss.
- Sprachliche Korrektheit: Achte auf Grammatik, Rechtschreibung und Ausdruck.
- Zitate korrekt angeben: Vermeide Plagiate.
- Üben, üben, üben: Je mehr du übst, desto besser wirst du!
Zusammenfassung
Die materialgestützte Erörterung ist eine komplexe, aber lohnende Aufgabenform. Sie fördert das kritische Denken, die Analysefähigkeit und die argumentative Kompetenz. Indem man die oben genannten Schritte befolgt und fleißig übt, kann man diese Herausforderung erfolgreich meistern und eine überzeugende Erörterung verfassen. Denke daran: Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg! Und Materialverständnis sowie eine starke eigene Meinung sind dabei unerlässlich.